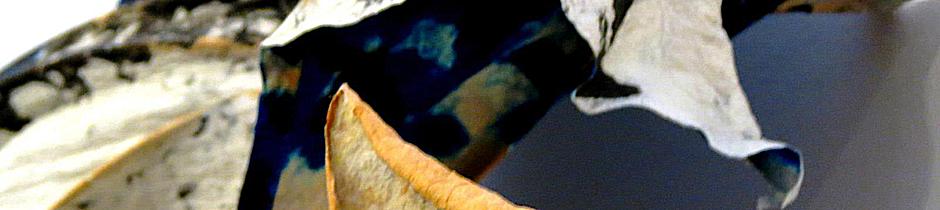
Text
Texte:
-
Städtische Galerie Tuttlingen, 2022
aus Papier, Kunstkreis Tuttlingen Juni/Juli 2022
"Ich möchte durch architektubezogene Installationen mit meinen Papierobjekten ästhetische Erfahrungsräume herstellen, deren Schönheit und narrative Aura Gefühle hervorrufen und zu erneuerbaren Haltungen verleiten." -
Hans-Thoma Kunstmuseum Bernau: Trialog Dezember 2020
-
Papierobjekte und Galeriebesucher in einem Raum
Wilhelm Morat Schwebende Konstellation 2021 -
Einführungsrede anlässlich der Vernissage zur Ausstellung: Wilhelm Morat: “Barock“ Papierobjekte aus Hanf und Flachs am 17.09.2017 im Kunstverein Das Damianstor Bruchsal e.V., 17.09.-15.10.2017
Dr. Martina Wehlte -
„Verfahren des Fühlens“ Prof. Dr. Silke Helmerdig
Wilhelm Morat & Jacqueline Santos de Freitas
Schloss Tiengen, WT 2016 -
„Lyrische Fragmente“ Zara Tiefert-Reckermann
Radbrunnen Breisach 2015
-
„Ungesichertes Gelände“ Dr. Jürgen Glocker
Laudatio zur Verleihung des Naturenergie Förderpreises im Hans-Thoma Museum Bernau 2014
-
„Torsi und Fragmente“ Nikolaus Cybinski
Kunstpalais Badenweiler 2012
-
„Von der Landnahme zur Hochkultur“
Adrienne Braun, Stuttgart 2008
-
„Kulturmaterial Papier zwischen Transformation und ästhetischem Recycling“ Susanne Jakob M.A.Langenhagen 1996
Hans-Thoma Kunstmuseum Bernau: Trialog Dezember 2020
WILHELM MORAT, Papierkunst seit 1980
Meine künstlerische Position setzt nicht so sehr auf Anschauung und Analogie, sondern fordert in ihrem Inhalt, vergleichbar mit der künstlerischen Position des dänischen Künstlers Olafur Elliason, einen interdisziplinären Perspektivwechsel zu Koexistenz und Symbiose. Wir Menschen müssen uns als Teil des Systems begreifen und nicht als Ordnung schaffender Gegenspieler der Natur aufspielen. Wir müssen folglich vom Konkurrenzkampf zur Koexistenz und Zusammenarbeit übergehen.Teamwork ist angesagt!
In Rückerinnerung an des amerikanischen Philosophen John Deweys „Art of Experience“ verbleibt das Kunstwerk nicht in sich selbst, es ist Anstoß für eine über den Gegenstand hinausreichende Erfahrung, die durch keine Theorie ersetzt werden kann. Das Kunstwerk ist Ausgangspunkt für die Interaktion mit der Welt, und anstelle der Immanenz der Kunst, wie sie der Minimalismus postuliert, tritt Transzendenz. Damit teile ich Richard Tuttles Humanismus und seinen Wunsch, mit den Betrachtern meiner Werke in Kontakt zu treten.
Gedichte für das Anthropozän
Marion Poschmann NIMBUS
… wie Flügel gegen sinkendes Abendlicht
Wir befinden uns im Endzeitalter, das durch die massive Intervention des Menschen in Landschaft, Klima und Artenvielfalt geprägt ist. Poschmann reagiert darauf mit wunderbaren Gedichten, die vom irreversiblen zerstörerischen Eingriff in die Natur erzählen und zugleich der noch nicht verschwundenen Magie der einzelnen Naturphänome zu sinnlicher Präsenz verhelfen.
Vorgesehene Werke:
An der Westwand eine Installation aus handgeschöpften Hanfpapierobjekten (kein Industriepapier) + zwei Sockel (je 40x40cm)Objekte in den angrenzenden Nischen.
Im Gang: 2 Doppeldecker, 2016/17,Hanfpapier, weiß
Korrespondenzarbeit zu Kolibri: „Tuttle Parade“, 2020, 3 kleine pigmentierte Objekte eine Huldigung an den amerikanischen Bildhauer Richard Tuttle und seine Ausstellung: „schön – fließend“ Winterthur 2016
Korrespondenzarbeit zu Steier: „das Sichtbare und das Unsichtbare“, 2020 Triptychon aus pigmentiertem Hanfpapier; vertikale Rhythmisierung versus horizontalen Bildaufbau
„Wegzeichen“, 1988, Pappmaché Quader, massiv aus Ausstellung: Papierreflexion, Papierkunst in BW (Bücheler, Erb, Harr, Morat, Stoll u.s.w.)
Papierobjekte und Galeriebesucher in einem Raum Wilhelm Morat Schwebende Konstellation 2021
Wilhelm Morat s Papierobjekte entstehen im Dialog zwischen dem Körper des Künstlers und dem aus der Fläche heraus entstehenden Körper des Werkes. Bei diesem Dialog lässt sich Morat immer wieder von seinem Material überraschen. Durch Versuchsreihen entstehen Papierobjekte aus dem Materialverhalten heraus. Bei diesen Prozessen bleiben die Arbeiten immer im körperlichen Maß, also in Relation zum Körper des Künstlers, und der späteren Betrachter.
Morat reagiert mit seinen Arbeiten immer auf seine Leibwahrnehmung des Ausstellungsraumes.
Wir alle erfahren die Welt durch das in ihr sein, durch unsere Verortung in ihr. Besonders gut können wir das in Ausstellungsräumen feststellen, noch besser, wenn es sich um eine Installation handelt. Dann nämlich befinden wir uns nicht einfach nur in einem Raum, in dem wir unsere Position finden müssen. Wir müssen uns zudem noch zu den Kunstwerken positionieren, mit denen wir den Raum teilen und die den Raumeindruck mitprägen.
In der Städtischen Galerie Tuttlingen zeigt Morat sich im Luftraum bewegende Hanfpapierobjekte, „die Doppeldecker und Flying Torsi“, Diptychen aus faserpigmentierten Flachspapierobjekten an der Wand, im Zentrum des Erdgeschosses ein großes Pappmachéobjekt mit dem Titel: „Nach oben offen“, das sich zwischen Boden und Decke spreizt und optisch die Raumluft verquirlt. Im Untergeschoß zieht sich eine schwarze Papierschnurzeichnung: „Blackline“ über die Wand und ein massiver Pappmachéquader setzt ein Wegzeichen.
Einführungsrede anlässlich der Vernissage zur Ausstellung: Wilhelm Morat: “Barock“ Papierobjekte aus
Hanf und Flachs am 17.09.2017 im Kunstverein Das Damianstor Bruchsal e.V., 17.09.-15.10.2017
Dr. Martina Wehlte
Meine Damen und Herren,
Papier ist nicht gleich Papier, das ist eine Binsenweisheit, aber so recht bewusst wird sie uns erst, wenn wir aus dem Meer des industriell produzierten Kopier-, Prospekt-, Geschenk-, Taschentuch-, Toiletten- und Packpapiers zufällig einen Bogen Büttenpapier fischen. Wenn wir statt der glatten oder maschinell gestanzten Oberfläche eine porige, unregelmäßige Struktur wahrnehmen, deren besondere Qualität wir sehen und ertasten können. Darauf schreibt man ein wenig sorgfältiger und mit Tinte statt Kugelschreiber, zeichnet weich, aquarelliert oder druckt. Aber hier wie dort ist das Papier nur Mittel zum Zweck einer schriftlichen oder bildlichen Mitteilung, ein Trägermaterial eben. Als Werkstoff wird Papier mit Schere, Skalpell und Leim zu filigranen Blüten, Wurzelgeflechten, phantasievollen dreidimensionalen Objekten oder ganzen Stadtarchitekturen geschnitten, gefaltet, gebogen, geklebt. Charles Young oder der Däne Peter Callesen haben in jüngster Zeit mit derartigen Arbeiten Aufsehen erregt.
Welchen eigenen Ausdruckswert aber Papier als Naturstoff hat, welche Gestaltungsmöglichkeiten in ihm als einem unabhängigen Medium stecken, das führt uns der Papierkünstler Wilhelm Morat vor. Er arbeitet seit 1981 mit selbst hergestelltem Papier, eine geraume Zeit lang auch mit Zeitungspapier und Pappmaché, das ihm angesichts der Digitalisierung medialer Nachrichtenübermittlung aber inzwischen als unzeitgemäß erscheint. Auf der Internetseite des Papiermuseums Gleisweiler bekommen Sie noch einen guten Eindruck von dieser früheren Werkphase, die hier im Damianstor nicht vertreten ist. Die Bruchsaler Ausstellung zeigt dreiunddreißig Arbeiten aus den Jahren 2010-2017. Das Verbindende zu den vorausgegangenen Schaffensdezennien ist zum einen das raumgreifende Moment der Papierfläche, die sich in die Dreidimensionalität hineinentwickelt bis hin zum vollplastischen Eindruck beispielsweise der beiden kleineren Arbeiten an der Fensterseite des oberen Mittelraums auf einem Sockel bzw. in Wandhängung. Es sei hier angemerkt, dass Wilhelm Morats Kunststudium in Freiburg einen bildhauerischen Schwerpunkt hatte, was ihn nachhaltig geprägt hat. Zum anderen ist die Verwendung selbst hergestellten Flachs- bzw. Hanfpapiers, in das Draht eingebracht wird, durchgängig. Im Rahmen eines Land-Art-Projekts hatte der in Titisee-Neustadt ansässige Künstler vor langem die Pflanzen angebaut, geerntet und in großem Vorrat gelagert. Sie werden nun nach Bedarf in einer eigenen Mühle gemahlen, mit Wasser zu einem fasrigen Brei verrührt und in Sieben geschöpft. Ihre Naturfarbe ist helles Braun, das entweder so belassen oder - wie bei den Hanfarbeiten im zweiten Stock – mit Sauerstoff gebleicht wird. Unter den Flachspapier-Objekten hier im ersten Stock befindet sich eine Dreiergruppe kleiner Torsi, deren bräunlicher Naturton mit Blau bzw. Grün übermalt ist. An dem gegenüberliegenden Deckensitzer kann man durch die unterschiedlichen, direkt ans Papier gebundenen Farbpigmente deutlich den schichtweisen Aufbau des Objekts erkennen. Dazwischen und am Rand der Arbeit wurde mit Eisen legierter Kupferdraht verbracht, der im Kontakt mit dem feuchten Papierbrei in kleinen braunen Pfützen ausgelaufen ist, so dass ein kettenartiger Farb-Strang die Fläche durchzieht. Grünliche Linien in anderen Objekten lassen hingegen auf reinen Kupferdraht schließen.
Die kurzen Flachsfasern sind nur durch das Mahlen bearbeitet, nicht durch chemische Stoffe wie in der industriellen Papierherstellung. Das Quetschen der Faser und anschließende Aufpumpen mit Wasser schafft ein vitales Material, das sich im Laufe des Trocknungsprozesses stark verändert. Durch das Verdunsten schrumpfen und verhärten die Fasern, die Fläche zieht sich also zusammen und die Drähte werden mitgezogen und geben dem Objekt schließlich seine vom Künstler vorbedachte Form. Es entsteht eine Körperhaftigkeit; Volumen, das durch seinen eingeschlossenen Hohlraum große Leichtigkeit erhält. Was wir vor Augen haben, ist das Ergebnis einer gelungenen Kooperation des Künstlers mit der Natur. Besonders eindrucksvoll sind die korkenzieherartigen Torsionen der Objekte in diesem Mittelraum. Es sind ausgesprochene ‚Sommerarbeiten‘, denn sie entstehen ausgebreitet im Neustädter Atelier unter intensiver Sonneneinwirkung, die den Trocknungsprozess forciert. Diese spiraligen Torsi bezeichnen einen der vier gegenwärtigen Arbeitsstränge Wilhelm Morats. Daneben treten die farbigen Arbeiten, die Hanfgruppe im oberen Stockwerk und die neue Gruppe Das Sichtbare und Unsichtbare von 2017, die mit Kupfer- und Goldstaub pigmentiert ist. Diese Arbeiten haben einen hautartigen Charakter, dessen Struktur durch das Gautschtuch entsteht, auf das der Papierbrei aufgetragen wird. Die Drahtlinien verstärken die Assoziation noch, indem sie an dünne Hautfalten denken lassen.
Wie der üppige, bewegte Faltenwurf eines schweren Stoffes wirken hingegen die Barock-Objekte aus dem vorigen Jahr, die der Ausstellung ihren Titel gaben. Auch ihre Oberfläche ist von Metallstaub durchsetzt. Immer wieder zieht man bei der Betrachtung von Wilhelm Morats Werken Parallelen zu Naturformen. Waren es bei früheren Bodenarbeiten vermeintliche Ähnlichkeiten mit Tieren, so sind es heute eher solche mit trockenen Blättern oder - in Anbetracht der jüngsten Werkgruppe – mit Schmetterlingsflügeln, einem Fühler. Dabei handelt es sich um die als Fragmente bezeichneten fragilen, eher grafisch wirkenden Arbeiten im oberen Kabinett, von denen in trockenem Zustand Flächen herausgeschnitten wurden. Schließlich noch ein Hinweis auf den frei von der Decke schwebenden Doppeldecker. Dieses zweiteilige Objekt, das durch weiß eingefärbte Wäscheklammern austariert ist, bewegt sich durch Luftzug und Thermik und veranschaulicht eine Leichtigkeit des Fliegens nicht zuletzt durch die besondere Lichtwirkung auf seiner Oberfläche.
Zusammen mit der Bruchsaler Ausstellung hat Wilhelm Morat allein in diesem Jahr zwischen Basel und Wiesbaden zehn Projekte, deren geografischer Schwerpunkt im deutschen Südwesten liegt. Es sind Einzel- und Gruppenausstellungen sowie die Teilnahme an einem Symposium über Herstellungs- und Verfallsprozesse in der zeitgenössischen Kunst vor knapp zwei Wochen. In Wiesbaden läuft unter dem Titel Naturliebe – erneuerbare Haltungen noch bis zum 15. Oktober eine Ausstellung des Künstlervereins Walkmühle, in der Wilhelm Morat auch vertreten ist. „Was kann Kunst leisten, damit wir unsere Haltung zur Natur hinterfragen?“ So fasst Prisca-Maria Riedel in einem kurzen 3-SAT-Bericht das Thema dieser Schau zusammen, um deren Teilnahme sich über vierhundert Künstler und Künstlerinnen beworben hatten. Der Blick der fünfundvierzig letztlich ausgewählten richtet sich auf Naturfundstücke, Naturprodukte in ihrem lebendigen Prozess des Werdens und Vergehens, des Wachsens, Reifens, Gärens und Verfallens; auf das Gesamtphänomen Natur und nicht auf das Temporäre einer Einzelerscheinung mit ihrem zwangsläufigen Ende bzw. Tod. Für sie alle steht das Potential fortwährender Erneuerung in natürlichen Prozessen im künstlerischen Fokus. Und auch Wilhelm Morat katalysiert dieses innovative Potential des fortwährenden Wandlungsprozesses in der Natur, ohne es chemotechnisch zu verändern. Er stellt den Naturstoff in einen Kontext außerhalb unserer Alltagserfahrung und gibt ihm damit einen neuen, ungeahnten Wert.
In diesem Sinne beschreibt Wilhelm Morat seine Herangehensweise wie folgt:
„Deshalb erscheint es mir äußerst sinnvoll, genauer hinzusehen und experimentell zu erforschen, was der Rohstoff aus seiner Natur heraus leisten kann und diese Möglichkeiten … ganz von Anfang an mitzudenken. … Durch die konzeptuelle Vorbereitung des Prozesses und die Integration der natürlichen Abläufe entstehen die Kunstobjekte.“
Die Ausstellung mit Wilhelm Morats Werken zeigt: Sowohl die unerschöpfliche Energie, die Schönheit, Kreativität und Intelligenz des Gesamtorganismus Natur als auch der sinnliche Reiz und die immanente Wirkungskraft seines Materials, dem der Künstler Form gibt, verdienen unsere absolute Wertschätzung, - jenseits technischer Manipulationsmöglichkeiten und weit über ein billiges Umweltbewusstsein hinaus.
Verfahren des Fühlens
Silke Helmerdig
Rose is a rose is a rose, schrieb Gertrude Stein 1913. Ich vermute, viele von Ihnen kennen dieses berühmte Zitat. Warum beginne ich mit diesem Satz? Das Denken der Welt existiert erst durch unsere Wahrnehmung. „(…) man kann die Natur nicht ohne Geist denken, schreibt Maurice Merleau-Ponty. Nichts ist, was es ist, bevor wir es durch unser Erkennen und unsere Benennung dazu machen. Die Rose, ein Haus, ein Baum, aber auch ein Kunstwerk wird erst durch unsere Wahrnehmung und Benennung zu dem entsprechenden Ding. Kunst ist eine Art und Weise, die eigene Erfahrung der äußeren Welt sinnlich umzusetzen und für andere erfahrbar zu machen.
Kunst erfordert einen Künstler, und dieser Künstler ist oder war ein lebender, atmender Mensch mit einem verleiblichten Selbst (…), schreibt Siri Hustvedt. Und später in demselben Text: „Der Künstler wirft etwas von sich selbst in die Welt hinaus“. Der Künstler und die Künstlerin, deren Werke hier ausgestellt sind, haben sich über ein theoretisches Interesse getroffen: es ist das Interesse an dem französischen Phänomenologen Maurice Merleau-Ponty und seinen Schriften. Für Merleau Ponty sind das Erfahren der Welt durch den eigenen Körper und das Herstellen von Kunst sich ähnelnde Prozesse, „Wahrnehmen bedeutet, sich etwas mit Hilfe des Leibes zu vergegenwärtigen,“ schreibt Merleau Ponty. Wir erfahren den Außenraum durch unseren Körper. Lambert Wiesing spricht in diesem Zusammenhang von „Leibeswahrnehmung“. „Das Machen von Kunst erfordert“, laut Siri Hustvedt, „einen Drang, etwas zu tun, eine verleiblichte Intentionalität.“ Und sie schließt daraus, dass „Kunstwerke (…) Spuren dieser verleiblichten Intentionalität (tragen)“. Die Erfahrung des Außenraums durch den Körper, die Leibeswahrnehmung wird in künstlerischen Prozessen umgesetzt.
Rose ist eine Rose ist eine Rose. Die Bedeutung von Sprache oder auch von Gesten liegt nicht in den Elementen, aus denen sie sich zusammensetzen. Die Bedeutung entsteht nicht durch Verständnis, sondern durch Erfahren, eben durch Leibeswahrnehmung.
Kunstwerke entstehen im Dialog zwischen dem Körper des Künstlers/ der Künstlerin und dem entstehenden Körper des Werkes.
Im Dialog lässt sich Wilhelm Morat von seinem Material überraschen.Durch Versuchsreihen entstehen seine Papierobjekte aus dem Materialverhalten heraus; aus der natürlichen Schrumpfung seiner selbst hergestellten Papiere um Kupferdrähte entstehen Formen. Angelegt in der Fläche entwickeln die Arbeiten ihr Volumen zu Körpern im Raum in ihrem Trocknungsprozess. Dabei bleiben seine Arbeiten immer im körperlichen Maß, also in Relation zum Körper des Künstlers, und der späteren Betrachter und Betrachterinnen.
)…(
Beide, Wilhelm Morat und Jacqueline Santos de Freitas haben in ihren Arbeitsprozessen auch auf ihre Leibwahrnehmung des Ausstellungsraumes reagiert. Sie haben die Ausstellungsräume auf sich wirken lassen und mit diesen Wirkungen des barocken im Kopf – und im Leib – ihre Arbeiten entwickelt, ohne dass diese direkt Spuren des Barocken zeigen. Denn der Raum, in dem wir uns befinden, ist Teil unserer Wahrnehmung. Jeder der beiden hat sich je auf einen Raum eingelassen, während im Untergeschoss ein Dialog der Arbeiten beider entsteht. Sehr verschiedene Figuren treffen aufeinander und begegnen sich.
)…(
Nun gilt das gerade gesagte nicht nur und exklusiv für Künstler und Künstlerinnen. Wir alle erfahren die Welt durch das in ihr sein, durch unsere Verortung in ihr. Besonders gut können wir das in Ausstellungsräumen feststellen, noch besser, wenn die ausgestellten Kunstwerke räumlich sind, oder auch raumgreifend. Dann nämlich befinden wir uns nicht einfach nur in einem Raum, in dem wir unsere Position finden müssen. Wir müssen uns zudem noch zu den Kunstwerken positionieren, mit denen wir diesen Raum teilen und die den Raumeindruck mit prägen. Kunstwerke sind Objekte, die sich im Raum manifestieren und die sich beim Eintreten eines Besuchers in den Galerieraum von einer ausgewählten Seite präsentieren. In seinen Schriften zur Wahrnehmung beschäftigt Merleau-Ponty die Frage, wie wir mit der einseitigen Ansicht eines Objektes im Raum umgehen. Wir wissen um die Existenz der Rückseite, der nicht-sichtbaren Seiten. Aber wir können sie uns vorstellen.„Wenn ich sage, dass diese nicht wahrgenommenen Seiten vorgestellt sind, setze ich stillschweigend voraus, dass sie nicht als gegenwärtig existierend erfasst sind, denn das, was vorgestellt ist, befindet sich nicht hier vor uns, ich nehme es nicht wirklich wahr. Es ist etwas nur Mögliches“, schreibt Merleau-Ponty.Die nicht sichtbare Seite gehört in die Welt der Vorstellung.
Und die Möglichkeiten, die diese Vorstellung uns offeriert, machen den Ausstellungsbesuch spannend. Werden wir enttäuscht? Werden sich unsere Vorstellungen erfüllen, beim Umschreiten der Skulpturen? Die Möglichkeit ist ein noch nicht eingelöstes Versprechen, ein noch nicht Bekanntes. Dieses noch nicht Bekannte regt unsere Vorstellung an. In diesem „noch nicht“ liegt etwas Utopisches. Für Ernst Bloch treibt uns genau dieses „noch-nicht“ an. Es ist das Motiv, die Motivation unsere Neugier, die uns zur Erkundung antreibt, zur Erkundung der Möglichkeiten .Beim Besuch einer Ausstellung von Skulpturen ist es der Antrieb zur Erkundung der bis dahin nur vorgestellten Rückseiten, die bis zum Umschreiten alle Möglichkeiten unserer Vorstellung in sich tragen.
Und gerade zur Vernissage treten die Objekte nicht nur in Beziehung zum Raum und dem einzelnen Betrachter/ der einzelnen Betrachterin; sie vermengen sich mit der Erfahrung aller Figuren im Raum, sowie des Raumes an sich. Sie gehen einen Dialog ein mit den Besuchern und Besucherinnen, gruppieren sich mit diesen im Raum und werden nun in Beziehung auf deren körperlichen Anwesenheit wahrgenommen. Konzentrierter und kontemplativer wird die Wahrnehmung des eigenen Körpers in Beziehung zu den Skulpturen im später wieder menschenleeren Raum. Skulpturen sind gleich zweifach Objekte eines Verfahrens des Fühlens: in ihrem Entstehen aus einem Verfahren des Fühlens heraus, und bei ihrer späteren Betrachtung als ein verfahren des Fühlens, das sich einem rein intellektuellen Verständnis der Skulptur entzieht.
Diese Ausstellung fordert Sie als Betrachter und Betrachterinnen auf, sich die Objekte zu erschließen, sie mit dem Leib wahrzunehmen. Folgen Sie Ihrer Vorstellung der nicht-sichtbaren Seite, überprüfen Sie diese und vielleicht verwerfen Sie sie auch. Erfahren Sie die Räume des Schloss Tiengen in einer durch die Kunstwerke (und die heutige Besucherkonstellation) veränderten Form und folgen Sie dem Vorschlag von Wilhelm Morat und Jacqueline Santos de Freitas, die Ausstellung durch ein Verfahren des Fühlens wahrzunehmen. Lassen Sie die Werke ein zweites Mal werden und Bedeutung erlangen.
Wilhelm Morat. Lyrische Fragmente – Arbeiten auf Papier
Zara Tiefert-Reckermann
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Wilhelm, liebe Kunstfreunde,
Der griechische Philosoph Thales von Milet stellte bereits 600 v. Chr. fest:
„Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, denn das Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück."
Wasser ist der Quell des Lebens und Ursprung allen Seins. Auch dieser historische Ort, der Radbrunnenturm, diente ehemals der zentralen Wasserversorgung der Stadt Breisach. Wasser kennt keine Grenzen
und zeigt zugleich dem Menschen seine Grenzen auf. Seine immense Kraft lässt und oft fassungslos zurück. Und dennoch bildet es die Grundlage unserer menschlichen Existenz.
Wasser ist auch für die Kunst Wilhelm Morats zentral, dessen Arbeiten aus Papier unter dem Titel „Lyrische Fragmente“ hier gezeigt werden. Zum einen dient es ihm als Inspiration, wie etwa bei den im
Erdgeschoss gezeigten, vom Mittelmeer inspirierten Objekten. Die mit blauen Pigmenten eingefärbten Arbeiten erinnern unmittelbar an das Meer und seine Wellen, wie es der Künstler bei seinen
Aufenthalten in Südfrankreich gesehen hat. Zum anderen ist Wasser zentral für den Herstellungsprozess der Objekte. Mehr dazu gleich.
Wilhelm Morat, 1954 in Neustadt geboren, ist Papierkünstler. Über sein Interesse und seine Leidenschaft für Literatur und Kunst kam er zum Werkstoff Papier, welches für den Künstler beides
miteinander vereint.
Wie wird man Papierkünstler? Wilhelm Morat studierte zunächst Kunst und Deutsch an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Seit 1998 ist er Mitglied der Internationalen Vereinigung der
Hand-Papiermacher und Papierkünstler, wo er auch die jährlichen Weltkongresse besuchte und im Austausch mit anderen Künstlern, sich die Papierkunst immer mehr zu eigen machte. Hinzu kam die Mitarbeit
und Ausbildung in renommierten Paper Art Studios, wie bei Peter Gentenaar in Den Haag oder John Gerard in Köln. Parallel absolvierte der Künstler kunstgeschichtliche und kunsttheoretische Studien,
etwa an der Uni Basel.
Die Papierkunst ist eine noch recht junge Kunstrichtung. Erst in den 1960er Jahren gab das Papier seine dienende Funktion als Mal- oder Zeichengrund auf und wurde zum autonomen schöpferischen
Sprachmittel. Heute ist Papier autark und ein unabhängiges künstlerisches Ausdrucksmittel.
Der künstlerische Prozess beginnt bei Wilhelm Morat mit dem Anpflanzen von Flachs und Hanf, welche der Künstler erntet und in der selbst konstruierten Papiermühle zu Faserbrei verarbeitet. Zwischen
die nassen Papierschichten legt er Kupferschweißdrähte. Beim nun folgenden Trockenprozess beginnt die Transformation des Naturprodukts zum Kunstwerk. Durch das langsame Verdunsten des Wassers
schrumpfen die Papierfasern zusammen und das Papier entwickelt ungeahnte Kräfte, sodass der Draht sich zu verformen beginnt und das Papier zum dreidimensionalen Kunstobjekt mutiert. Mit wenigen
gezielten Eingriffen lenkt der Künstler diesen Prozess. Wie unterschiedlich das Ergebnis dabei ausfallen kann zeigen die verschiedenen Werkgruppen in dieser Ausstellung.
Beginnend im Erdgeschoss sind drei von der Mittelmehrsehnsucht des Künstlers inspirierte Objekte zu sehen. Die blauen Farbpigmente stammen aus Frankreich. Bereits während des Herstellungsprozesses
wird der Faserbrei mit den Pigmenten angereichert. Gestalterisch reichen die Objekte vom flachen, eher stillen, tiefblauen Gewässer bis hin zur heftig sprudelnden Woge. Die sogenannten „Papiers
mediterrannées“ sind wie das Element „Wasser“ von einer lebendigen Empfindung, tiefen Emotionen sowie Gefühlsreaktionen geprägt. Letztlich offenbaren sie uns die Hingabe des Künstlers an das
Leben.
Vom Element „Wasser“ kommt der Besucher, um bei den Elementen zu bleiben, im 1. Obergeschoss zum Element „Erde“. In der archetypischen Elementen-Lehre steht die „Erde“ für das Körperlich-Sinnliche,
für die greifbare verdichtete Energie der Materie wie auch die geformte Struktur. Im 1. Obergeschoss zeigt der Künstler seine sogenannten blacklines und einige frühe Collagen. Die blau leuchtende
Farbigkeit der Mittelmeerobjekte ist einer erdgebundenen, eher dunkleren Naturfarbe gewichen. Auch ändern sich die Objekte in ihrer Gestaltgebung. Ein großer, stark eingerollter, naturfarbener Torso
trifft auf zwei von schwarzen Linien durchzogenen Papierobjekte. In der vierten Wandarbeit schließlich entwickelt sich die schwarze Linie zum eigenständigen Objekt im Raum. Bei dieser Arbeit tritt
erstmals ein künstlerisches Mittel in Erscheinung, welches im 2. Obergeschoss schließlich zum gestaltgebenden Medium werden wird: die Fragmentierung. Die Arbeit trägt den Titel blackline/cut. Dies
weist einerseits auf den tatsächlichen Schnitt, der den schwarzen Torso zerstört bzw. fragmentiert, hin. Andererseits kann man den Beititel auch auf das Gesamtobjekt beziehen, das so zu einer Art
Schattenschnitt, einer Schattenzeichnung an der Wand wird.
Die Natur als wichtiger Kooperationspartner für die Kunst Morats tritt noch deutlicher als in den dreidimensionalen Objekten in den Collagen aus den späten 1990er Jahren in Erscheinung. Bei diesen
Arbeiten aus handgeschöpften Pflanzenpapieren legt der Künstler eine Stahlplatte ins Gras, die aufgrund unterschiedlicher Gräser und Strohsorten verschieden oxidiert und entsprechend diverse Spuren
im Papier hinterlässt. Hier wird sehr deutlich, wie die Natur bzw. natürliche Vorgänge das Werk Morats beeinflussen. Künstler und Natur stehen in einem ständigen Dialog. Dabei verbinden sich
künstlerisches Wollen und die Gesetzmäßigkeiten der Natur, die sich der Künstler im Laufe der Jahre zunehmend angeeignet hat, auf einzigartige Weise.
Im obersten Stockwerk wird es schließlich luftig leicht, alles scheint zu schweben bzw. zu fliegen. Der Physiker Rudolf Treumann schreibt: „Das Element des Fliegens ist die Luft. Es ist das Element
des Menschen, auch wenn er von Natur aus nicht zu den fliegenden Lebewesen zählt. Er atmet in ihr, bewegt sich in ihr, lebt von ihr.“ Womit wir beim Element der „Luft“ angekommen wären, wenn man an
dieser Stelle nochmals die Elementen-Lehre bedienen möchte. „Luft“ steht für Atem, die Bewegung im Denken, in der Kommunikation und im Handeln.
Im zweiten Obergeschoss zeigt Morat seine sogenannten Torsi, Fragmente und hier zentral im Luftraum die Flying Fragmente, seine neusten Arbeiten. Alle Werke sind weiß und werden lediglich von feinen,
rostfarbigen Linien durchzogen, welche aufgrund der oxidierten Kupferschweißdrähte entstehen. Die Brechung des Lichts an der Oberfläche und in den Hohlflächen ist fester Bestandteil der
Arbeiten.
Die lyrischen Fragmente entwickeln eine geradezu transzendente Wirkung hier im Radbrunnenturm. Transzendenz kommt vom lateinischen Wort „transcendere“, was so viel bedeutet wie „überschreiten“ oder
„übersteigen“.
Der Mensch ist ein endliches Wesen. So sind wir zwar Teil einer für uns durschaubaren und begreifbaren Wirklichkeit, andererseits aber erleben wir diese Wirklichkeit durch die Endlichkeit unseres
Erkenntnisvermögens als begrenzt. Und so wecken die lyrischen Fragmente Wilhelm Morats in uns eine gewisse Sehnsucht nach dem Übersinnlichen und Jenseitigen, dem die Immanenz alles geschöpflichen
Seins untergeordnet ist. Die „Flying Fragmente“ scheinen jegliche Schwerkraft zu überwinden und sich jedem Zweck zu entziehen. Sie sind wie Zeichen der Selbstbehauptung gegen die Hektik und
Schnelllebigkeit unseres Alltags, welchem sie zu entfliehen suchen.
Durch die Farbwahl werden die Objekte ganz auf das Material reduziert. Weiß steht für Reinheit, Licht und Entmaterialisierung – wird somit zum Inbegriff der Seinserfahrung. Licht und Schatten, Raum
und Atmosphäre definieren sich in den Arbeiten Morats immer wieder neu. Und Licht wird letztlich zum immateriellen Material des Werks, das sich scheinbar im Nichts verflüchtigt.
Der Künstler betitelt diese Arbeiten „Torso“ oder auch „Fragment“. Beides steht für etwas Unvollendetes oder auch Bruchstückhaftes. Als ästhetisch wertgeschätzte – und in diesem Sinn auch angestrebte
– Form ist das Fragment ein typisches Phänomen der Moderne. Adorno schrieb 1970 in seiner „Ästhetischen Theorie“: „Kunst obersten Anspruchs drängt über Form als Totalität hinaus, ins
Fragmentarische.“ Dabei begreift Adorno das Fragmentarische als etwas der Welt wesenhaftes.
Obwohl sich das Fragmentarische in Morats Werken als Fragmentarizität der Form darstellt, ist sie dennoch keine äußerliche, d.h. die Werke wurden vom Künstler durchaus abgeschlossen und sind auch als
solche begriffen. Der Fragmentcharakter ist ein innerer, ein vom Künstler bewusst gewollter.
Rein technisch gesehen, sind die „Fragmente“ eine Weiterentwicklung der „Torsi“. Mit dem Skalpell schneidet der Künstler Flächen aus den getrockneten „Torsi“ heraus. Dabei bleiben letztere in der
reduzierten Form des Fragments jedoch imaginär existent. Es sind zarte Objekte, die ein immenses Potenzial in sich tragen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung durch den Betrachter.
In den neusten Arbeiten, den „Flying Fragmenten“, werden die Ausschnitte nicht nur geschnitten, sondern bereits während der eigentlichen Herstellung, also im nassen Zustand, hineingegossen. Die zwei
Arten der Fragmentierung lassen sich anhand des scharfkantigen Schnitts auf der einen Seite und dem gegossenen, weichen Rand auf der anderen gut unterscheiden.
Die lyrischen Fragmente Wilhelm Morats sind keine Bruchstücke, Relikte oder Reste. Auch sind sie nicht das Versprechen auf die Wiederherstellung der einstigen Ganzheit. Die Frakturen der
Fragmentierung bleiben, sind irreparabel und zugleich sind sie die Fügstellen der neuen Identität eines möglichen Ganzen. Der französische Philosoph Jean-Luc Nancy schreibt in seinem Text „Die Kunst
– Ein Fragment“: „… - es (also das Fragment bzw. die Kunst) ist nichts anderes als die multiple, diskrete, diskontinuierliche und heterogene Berührung des Seins.“ Nancy kommt schließlich zu dem
Fazit: „Die Berührung fragmentiert und das Fragment berührt.“ In diesem Sinne lassen Sie sich von den lyrischen Fragmenten Wilhelm Morats berühren und entdecken Sie seine Kunst.
TORSI und FRAGMENTE
Ich möchte Sie im Folgenden mit einem Mann und seinen Werken bekanntmachen, dessen Tun – so weit ich das überblicke – einmalig ist. Wilhelm Morat aus Titisee-Neustadt, 1954 dort geboren, dann in Freiburg Kunst und deutsch studierend, danach als Lehrer arbeitend, ehe er als freischaffender Künstler in seine Geburtsstadt zurückkehrte, kam wie er bei unserem Treffen erwähnte, über die Literatur zu seinem Werkstoff Papier. Wären mir jetzt mehr als zehn Minuten gegeben, müsste einiges gesagt werden über die Rolle und Bedeutung des Papiers in der europäischen Kultur. Fassen wir das dennoch, thematisch eng geführt, in einem Satz zusammen: Keine Literatur ohne den elementaren Stoff Papier. Dem Literaturkenner Morat zuliebe erwähne ich kurz Goethe, der 1816 Suplice Boisserée brieflich von alten, einst beschriebenen Blättern berichtet und diese Papiere jetzt wieder vorgeholt hat, denn er „kann“, wie er schreibt, „ es nicht über sich gewinnen, dergleichen Blätter zu vertilgen, weil es immer DENKSTEINE vergangener Zustände bleiben.“ Papierne Blätter als Denksteine! Ist das nicht wunderbar gesagt? Wilhelm Morat stellt dergleichen „Blätter“ her, und da ich denke, eine kurze Beschreibung seiner Werkprozesse hilft uns bei ihrer Interpretation will ich sie referieren. Wilhelm Morat schöpft Papier, und mit dem Verb, genauer mit dem Nomen „Schöpfung“, assoziieren wir den Urprozess der ersten Tage der Welt. Inspiriert vom romantischen Gedanken der Versöhnung von Natur, Wissenschaft und Kunst beginnen die hier gezeigten Torsi und Fragmente ihr Leben in einem von Morat betreuten Land-Art-Projekt, wo er seine Naturfasern anbaut und erntet, und das macht er, weil er, wie er sagt, „mit der Natur kooperieren will.“ Das bedingt auch, dass er die Weiterverarbeitung der Lein- und Hanffasern zu Faserbrei selbst in seinem Atelier besorgt. Dieser Brei wird dann auf eine gerahmte ebene Fläche von ein Meter achtzig auf ein Meter zwanzig aufgebracht, mit Folie abgedeckt und von der Unterseite mit einer Vakuumpumpe entwässert. Eingelegte Kupferdrähte oxydieren und leisten Widerstand während des zwei- bis drei Tage dauernden Trocknens, in dem sich dank der unterschiedlichen Aggregatzustände der Materialien jene Formen ergeben, die Sie hier sehen. Zu ergänzen ist, dass die Einfärbung mit Pigmentfaserfärbung geschieht. Bis zum Vorgang des Trocknens ist die Gestaltung gleichsam programmiert, doch nun geht sie in einen sich selbst schaffenden Prozess über, der diese amorphen und geheimnisvollen Formen bildet, die Sie hier sehen. Anders gesagt: In den Torsi verbinden sich individuelles Wollen und Planen mit den natürlichen Eigengesetzlichkeiten des Materials. Das ist ein spannender Prozess, der jetzt nur scheinbar an sein Ende gekommen ist, in Wirklichkeit aber ebenso weitergeht wie der des Weltenschöpfers nach dem siebten Tag. Morats Benennung „Torsi“ meint keine Rumpfkörper in marmorner Starre wie wir sie aus der Antike kennen, sondern den geheimen Vorgang des sich Veränderns. Deutlicher wird das im romantischen Begriff des Fragments, das nichts Defektes meint, sondern die ihm eingeschriebene Potenz des sich kontinuierlichen Weiterbewegens und Vollendens im Unendlichen. Was hier wie erstarrt erscheint, lebt in Wirklichkeit, verändert und verwandelt sich in einem Zeitmaß, das mit unseren Vorstellungen nicht übereinstimmen muss. Folgen Sie mit ihren Blicken den kleinen, schwerelosen Fragmenten, die wie Vögel davonzufliegen scheinen, Vögel, an die Sie Ihre Gedanken hängen können, um mit ihnen in die luftigen Höhen der Fantasie aufzusteigen. Was mich an Wilhelm Morats Kunstproduktion beeindruckt, ist der gesamthafte Prozess ihres Entstehens. Gerade habe ich vor wenigen Tagen in der Fondation Beyeler gehört, dass der Amerikaner Jeff Koons an die 40, in dringenden Fällen bis zu 70 Maler beschäftigt, die seine großformatigen Bilder ausmalen. Das ist zwar, ins Extreme gesteigert, was Rubens und Cranach auch gemacht haben, und gibt dennoch zu denken. Dagegen nun Wilhelm Morat: Immer in unmittelbarer Nähe ungeteilt zu dem, was einmal Kunst werden soll und, wie Sie hier sehen, zu Kunst wurde. In Zeiten der Diskussion über die Aufhebung der individuellen Autorschaft ist sein Tun die wohltuende Ausnahme, die mich, und ich denke auch Sie, verehrte Kunstfreunde, in ihren Bann schlägt. Lesen Sie darum, wie der Brief schreibende Goethe, in diesen papiernen Werken Denksteine, Botschaften eines Menschen, der noch etwas nur ihm Gegebenes mitzuteilen hat und das mit uns teilen will.
Nikolaus Cybinski, anlässlich der Vernissage im Kunstpalais Badenweiler 2012
Rede Dr. Jürgen Glocker auf Wilhelm Morat am 26. April 2014 im Hans Thoma-Kunstmuseum in Bernau
Wer Flachs sät, wird Kunst ernten. So einfach, meine sehr geehrten Damen und Herren,
lieber Wilhelm Morat, so einfach ist das – und so kompliziert. So kompliziert wie das Leben. So kompliziert wie unsere hochgradig arbeitsteilig organisierte Welt, in der fast jeder etwas Anderes macht als sein Nachbar, und kaum jemand mehr den Überblick besitzt.
Sie alle kennen wahrscheinlich das Sprichwort: Wer Flachs sät, wird Kunst ernten.
Wussten Sie von diesem Zusammenhang? Ich hatte davon, das gestehe ich frank und frei, lange Zeit keinen blanken Schimmer. Für mich war das unbekanntes, ungesichertes Gelände, eine Terra inkognita.
Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Und deshalb möchte ich Sie herzlich einladen, mit mir gedanklich durch das schöne, ebenso unsichere wie ungesicherte Gebiet dieser im Wortsinn wunderbaren Ausstellung des neuen Preisträgers Wilhelm Morat zu spazieren – ganz im Sinne der Reveries d’ún Promeneur solitaire eines Jean-Jacques Rousseau, der Träumereien eines einsamen Spaziergängers. Aber bevor wir uns auf unsicheren Boden, auf ungesichertes Terrain begeben, verharren wir vielleicht noch einen Augenblick auf festem Grund und ante portas. Man kann nämlich auch ganz nüchtern und sachlich über Wilhelm Morats Arbeit sprechen, gewissermaßen technisch und nicht poetisch, so etwa über seine Torsi und Fragmente und ihre Genese.
Ihren Grundstoff, das Papier, stellt Wilhelm Morat, anders als das Gros seiner Kolleginnen und Kollegen Künstler, selbst her. Denn Morat vertritt nicht einen arbeitsteiligen, sondern einen ganzheitlichen Ansatz. Fast könnte man glauben, dass der belesene Künstler Wilhelm Morat hier unter dem Einfluss Adalbert Stifters steht, der beispielsweise in seinem Roman „Der Nachsommer“ dem klugen ganzheitlichen Denken nachdrücklich das Wort redet.
In einem ersten Schritt sät und erntet Morat jedenfalls zunächst Flachs und Hanf, die er riffelt, hechelt und bricht, um sie dann, in der eigenen selbstkonstruierten Papiermühle, zu Faserbrei zu verarbeiten und mit Farbpigmenten anzureichern.Bis hierher ist also der Landwirt und Handwerker Morat tätig, der als Mann der blauen Schürze sich auf die Kenntnisse des Naturwissenschaftlers und Forschers gleichen Namens stützt.
Erst anschließend tritt der Künstler Morat auf den Plan, wenn es darum geht, das Naturprodukt in ein Kunstwerk zu transformieren und mit der eigentlichen Ernte zu beginnen. Bei dem nun folgenden Dehydrierungsprozess nutzt Wilhelm Morat wiederum die Naturgesetze. Der Wissenschaftler und Naturkundige bleibt also aktiv:
Zwischen die verschiedenen Schichten des noch flüssigen Papiers legt der Künstler Kupferschweißdrähte. Das langsam verdunstende Wasser lässt die Papierfasern im Lauf der Zeit schrumpfen, das Papier entwickelt ungeahnte Kräfte, es gelingt ihm, als sei das ein Kinderspiel, die Drähte zu verformen, zu biegen, die zweidimensionale Fläche mutiert zum dreidimensionalen Raum. Eine Skulptur, ein Objekt wird geboren, wobei sich der künstlerische Form- und Stilwillen einerseits und die Gesetzmäßigkeiten der Natur andererseits notwendig durchdringen und ergänzen.
Mit Wilhelm Morats Geflechtobjekten hat es eine etwas andere Bewandtnis – obwohl auch sie wie die Torsi und die Fragmente mit dem Phänomen Zeit spielen und recht eigentlich auf ihm beruhen. Und obwohl auch sie auf die Werkstoffe Papier und Draht setzen.
Spielt Zeit mit Blick auf die Fragmente und Torsi bei deren Genese, bei ihrer Herstellung die entscheidende Rolle, bei der Metamorphose, beim Transformationsprozess des Materials, so haben die Geflechtobjekte eher statischen, speichernden Charakter.
Die anwesenden Journalistinnen und Journalisten mögen es mir nachsehen, wenn ich darauf hinweise, dass man landauf, landab sagt, nichts sei langweiliger als die Zeitung von gestern. Eine Tageszeitung – nomen est omen – ist ein flüchtiges, ein vergängliches Medium: Heute gelesen, morgen zum Einwickelpapier für Obst, Gemüse oder antiquarische Bücher umfunktioniert. Wilhelm Morat nutzt das ebenso preiswerte wie leicht verfügbare Medium Zeitung, das überdies durch die Strukturen des Papiers, des Drucks, durch Farb- und Schwarzweißfotos und durch eine schier unerschöpfliche sprachliche Varietät auch ästhetische Qualitäten besitzt, als einen Zeitspeicher, in dem die Fülle des Lebens, von der großen Politik bis hin zur Müllabfuhr und zur Discounteranzeige aufbewahrt ist: „Vermischtes“ im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Sammler, Materialkenner und Künstler Wilhelm Morat dreht Zeitungsdoppelseiten zu zigarrenförmigen Teilen und baut, flicht sie in einem zweiten Schritt in ein Drahtgeflecht ein. Aus Massenprodukten entsteht so ein individuell geformtes künstlerisches Objekt, das die Aura eines Originals besitzt. Aus bedrucktem Papier, aus grafisch akzentuierten ungezählten Zeitungsseiten werden raumbezogene Installationen von zauberhaftem, rätselhaftem Charakter. Die Haupt- und Nebenwege des Tagesjournalismus führen plötzlich in ungesichertes Gelände, münden in die freie Wildbahn von Kunst und Erfindung.
Der Begriff des „ästhetischen Recyclings“, der hin und wieder auf Wilhelm Morats künstlerische, auf seine poetische Verfahrensweise angewandt wurde, greift also viel zu kurz. Aber dazu später. Spazieren wir zunächst einmal ein Stück weiter und zwar in Wilhelm Morats sogenanntem Streichelzoo.
Seine jüngsten Objekte bestehen aus einem System miteinander verschränkter Dachlatten, die jeweils in drei Richtungen des Raums weisen und an drei Auflagepunkten den Boden berühren. Sie bestehen außerdem aus Materialien, die wir bei Wilhelm Morat schon kennengelernt haben: Denn in einem zweiten Arbeitsschritt benutzt Morat Maschendraht, verknülltes Zeitungspapier sowie Pappmaché unterschiedlicher Feinheitsgrade und baut mit ihnen Volumina, also Körper im weitesten Sinn auf. Um Abbildung und Mimesis geht es dabei in erster Linie nicht.
Morat folgt zunächst einmal nur den Vorgaben der hölzernen Richtungsachsen. Andererseits widerspricht er den Assoziationen, die in Richtung Tier oder gar Huhn führen, auch nicht – im Gegenteil. Denn ein Stück weit unterstützt er solche Interpretationen sogar oder leistet ihnen zumindest absichtlich oder fahrlässig Vorschub, wenn er seine Objekte, die des Humoristischen ganz und gar nicht entbehren, in der Nähe einer Leiter, einer Hühnerleiter?, gruppiert.
Der Betrachter ist erneut verunsichert, er ist ganz offensichtlich in ungesichertem Gelände unterwegs, gar keine Frage.
„Man ließ mich kaum mehr als zwei Monate auf diesem Eiland weilen ….“, schreibt Rousseau in seiner „Fünften Träumerei“ über seine Zeit auf der Insel im Bielersee, „doch hätte ich zwei Jahre, zwei Jahrhunderte auf ihm verweilen mögen, ohne mich auch nur einen Augenblick zu langweilen.“ Das trifft, mutatis mutandis, auch auf Wilhelm Morats ungesichertes Gelände zu, das alles Andere hervorruft als Langeweile, sondern größtes Vergnügen. Verweilen Sie also noch etwas mit mir auf diesem wunderbaren Eiland und schauen Sie zusammen mit mir genauer hin, bevor Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, sich selbst auf den Weg machen.
Einen Torso nennt man, laut Herderschem Lexikon, ein unvollständig erhaltenes oder unvollendetes plastisches Bildwerk (ohne Kopf und Glieder); bei Auguste Rodin wird der Torso erstmals zur beabsichtigten künstlerischen Form. Das Non-Finito darf als bedeutendes neues Stilmerkmal vieler seiner Werke gelten. Das Fragmentarische wird erst bei ihm zum ausdrucksstarken Stilmittel. Und auf das Ganze gesehen, wird der Torso, wird auch das Fragment zur Signatur der Moderne, die sich insbesondere nach den Katastrophen und Massakern des 20. Jahrhunderts vom intakten, vom integralen und geschlossenen Menschenbild weitgehend verabschiedet hat. Der Torso, das Fragment wird zur Chiffre für das Saeculum, ob nun ein Werk sich als unbeendbar oder ob es von vorneherein als Bruchstück konzipiert wurde. Denken Sie nur, ich nenne zur Abwechslung einige literarische Beispiele, an Musils „Mann ohne Eigenschaften“, an Kafkas Romane oder an das Spätwerk Becketts.
Und wie sind die Torsi Wilhelm Morats zu lesen, zu interpretieren? Bei ihm erscheinen die Torsi, deren Genese aus der Natur wir ja kennengelernt haben, weit ins Abstrahierende, ins Abstrakte vorgerückt. Sie haben sich sehr weit von traditionellen Torsi, vom Abbild von Körpern entfernt und öffnen sich den mehr oder minder freien Assoziationen der Betrachterinnen und Betrachter, sie kommen unseren Augen als poetische Gebilde entgegen, denen oftmals etwas von der Majestät großer Schwingen anhaftet. Oder von der Feinheit fragiler Gliedmaßen. Sie erscheinen als leichte, bewegliche und bezaubernde, ja beinahe als lebendige, als lebende Objekte, als Signa der Schönheit, des Zerbrechlichen und Verletzlichen, mithin als Chiffren für die Schönheit und Gefährdung der Natur, der Schöpfung, alles Lebendigen. Von der Materialität für einmal ganz zu schweigen. Morat setzt nicht auf Stein, nicht auf Holz, Stahl oder Bronze. Er hat sich für das Kreatürliche, für Pflanzliches, für Fragiles und Zerbrechliches entschieden.
Die Fragmente wiederum rekurrieren auf die Torsi. Sie markieren gewissermaßen die nächste Arbeitsstufe, Abstraktionsebene nach dem Torso, sie sind wie Verdichtungen, Destillate. Zu den Torsi verhalten Sie sich, wenn Sie mir für einmal eine saloppe Formulierung erlauben, wie der Ristretto zum Espresso. Musikalisch gesprochen könnte man sie als Engführungen bezeichnen.
Eignet den Fragmenten also eine gewisse Strenge, die in der Regel allen Reduktionen und Verdichtungen anzuhaften pflegt, besitzen die Geflechte häufig nicht nur die Anmutung filigraner Skulpturen und Objekte, sondern auch die von seltsamen, merkwürdigen Fabelwesen. Und sie erzählen, bei genauem Hinsehen, ja wirklich auch eine Fabel nach der anderen – wenn auch verhüllt. Sie bewahren unzählige Schichtungen, Geschichten und Fabeln auf, Fabeln und Geschichten, die ihren Weg in eine Zeitung und von dort ins Werk von Wilhelm Morat gefunden haben: Unerzählte Erzählungen. Ideengewimmel, Kunstgeflimmer. Morats Papierflechtwerke sind Erinnerungsspeicher, Zeitspeicher. Zugleich sind sie Monumente unserer alltäglichen Vergesslichkeit und Vergänglichkeit und haben weit mehr als ästhetisches Recycling zu bieten. Sie sind wiedergefundene, sie sind umgewandelte, verwandelte Zeit.
Hier in Bernau fallen insbesondere die „Drei Grazien“ ins Auge, die in den Naturfarben Grün und Blau sowie, scheinbar auf den ersten Blick naturbelassen, in Weiß daherkommen, wobei man bei der letztgenannten Schönheit noch am besten den Zeitungsdruck lesen kann: Ein federleicht-ironisch getöntes Paris-Urteil.
Besonders angetan aber haben es mir die Mitglieder von Wilhelm Morats sogenanntem Streichelzoo. Denn sie transportieren eine hohe künstlerische und semantische Komplexität. Diese Fabelwesen sind nicht zuletzt von souveräner Leichtigkeit – und eine solche Schwerelosigkeit und Leichtigkeit hinzubekommen, gehört, wie wir wissen, zum Schwersten und Schwierigsten in Sachen Kunst.
Diese Objekte aus dem Kerngebiet von Morats ungesichertem Gelände mögen tatsächlich an Vögel, an Hühner gar erinnern. Manches an ihnen gemahnt an Flügel, an Schnäbel, an Augen, an die charakteristischen Körperhaltungen und Bewegungen von Federvieh, aber sie bleiben vor allen Dingen doch autonome Skulpturen, Objekte, die sich in ihrer Materialität nicht laut, aber vernehmlich und deutlich zur Arte Povera bekennen und mit ihr allem Pathos und allem Ernst der zünftigen Großbildhauerei, komme sie nun in Bronze, Stahl oder gleich welcher Couleur daher, ironisch Valet sagen. Wilhelm Morat führt also auch einen ästhetischen, kunsttheoretischen Diskurs – und er tut dies auf intelligente, witzige und ästhetisch äußerst ansprechende Weise. Das Huhn aus Pappmaché ist ihm bedeutend näher als der Hüne in Bronze.
Unsere Welt ist vermessen – und das, so scheint mir, im doppelten Sinn des Wortes. Es gibt auf den Landkarten dieser Erde keine weißen Flächen mehr, keine Gebiete, die nicht vermessen wären, und oftmals sind wir Erdenbürger leider tatsächlich so vermessen zu glauben, dass wir alles im Griff hätten und dass es weit und breit kein ungesichertes Gelände gäbe. Das ist freilich in Tat und Wahrheit nicht der Fall, und wenn wir ehrlich sind, müssen wir an jedem Tag zur Kenntnis nehmen, wie unsicher und brüchig der Grund ist, auf dem wir uns bewegen, und wie schnell uns im Dickicht der Großstädte oder auch auf dem Boden des vermeintlich wohlvertrauten ländlichen Raums etwas widerfahren kann, womit wir nicht gerechnet haben.
Zum Glück jedoch gibt es die sogenannten schönen Künste, die uns eine Art Paralleluniversum zur Verfügung stellen, das uns dazu befähigt, die Augen zu waschen, die Augen zu öffnen und wach zu bleiben, die Sinne zu schärfen, kreativ zu sein und zu bleiben, die Schönheit der Welt und des Lebens immer wieder aufs Neue wahrnehmen zu können. Ein großartiges Experimentierfeld, ungesichertes Gelände von bester Qualität stellt uns Wilhelm Morat zur Verfügung, den wir heute ehren und auszeichnen. Wilhelm Morat ist ein großer Künstler und ein würdiger Preisträger.
Der Preisträger und ich: Wir sind seit exakt demselben Tag auf jenem unsicheren Gelände unterwegs, auf dem wir uns alle bewegen. Das verbindet ungemein.
Lieber Wilhelm, ich gratuliere Dir von Herzen zu dem schönen Bernauer Preis und ich bin sicher, dass ich dies im Namen von uns allen tun darf. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!
Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.
Von der Landnahme zur Hochkultur
Die „Torsi“ von Wilhelm Morat verhelfen dem Papier zur Autonomie
Papier ist eine wichtige Erfindung der Zivilisation. Willig trägt es das geistige Gut einer Kultur durch die Jahrhunderte. Papier legitimiert sich, indem es benutzt, bedruckt, beschrieben wird, das weiße Blatt dagegen steht für Abwesenheit von Information. Der Bildhauer Wilhelm Morat stellt sein Papier selbst her, nicht aus pathetischer Naturverbundenheit, sondern weil es konzeptionell notwendig ist. Er greift in jede Phase des Entstehungsprozess künstlerisch ein. Er baut die Faserbreie wie eine Skulptur zusammen. Er speist Farbpigmente ein, die die Fasern durchdringen. Er verlegt Drähte, die dem Material die Form einschreiben. Wilhelm Morat nutzt Papier nicht als Träger, sondern führt den Werkstoff zur Autonomie: Es wird selbst Botschaft.
Die „Torsi“ beginnen ihre Erzählung bei der Scholle, die die ersten Siedler nutzbar machten. Die Lineaments und Drahtzeichnungen wiederum durchpulst der ästhetische Gestaltungswille des Deus artifex, des Künstlers als Schöpfer. Zugleich brechen die skulpturalen Objekte aus in die Dreidimensionalität - und verweisen auf den Menschen als Konstrukteur und Städtebauer.
So erinnern die Formen an Architekturfragmente, aber auch an Körper, Florales oder Textiles. „Torsi“ ist doppeldeutig zu verstehen. Ob man Körperhüllen assoziiert oder Stoffe, es sind Fragmente, die auf einen Kontext verweisen und erst durch die Interpretation zur Vollendung gelangen. Zugleich weisen die Objekte über das Körperhafte hinaus und implizieren existenzphilosophische Fragen. Die Skulpturen erzählen nicht nur die Entwicklung unserer Kulturgesellschaft nach, sondern führen die arbeitsteilige, entfremdete Industriegesellschaft symbolisch zurück zu einer Einheit: agrarisches, kreatives und wissenschaftlich-konstruktives Schaffen koexistieren in diesen Kunstwerken in friedlichem Einklang.
So schlagen die fragilen wie kraftvollen Skulpturen einen Bogen von der Landnahme durch den Menschen bis zur hochkultivierten Zivilisation. Zugleich kommt das Papier zu sich selbst: Es trägt nicht den künstlerischen Geist, sondern gibt ihm durch seine Materialität Gestalt.
ADRIENNE BRAUN, Stuttgart 2008
Geflechte und Installationen
aus Tageszeitungen
Kulturmaterial Papier zwischen Transformation und „ästhetischem Recycling“
„… denn jeder weiß, dass der Künstler zugleich etwas vom Gelehrten und vom Bastler hat: mit handwerklichen Mitteln fertigt er einen materiellen Gegenstand, der gleichzeitig Gegenstand der Erkenntnis ist.“
Claude Lèvi-Strauss
In seiner Schrift „Das wilde Denken“ ordnet der französische Ethnologe Claude Lèvi-Strauss das künstlerische Schaffen einem Zwischenbereich zu, der zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und mythischem oder magischem Denken angesiedelt ist. Der Künstler hat, so die Schlussfolgerung Claude Lèvi-Strauss´, „zugleich etwas vom Gelehrten und etwas vom Bastler“, da sich dieser „mit Hilfe von Mitteln ausdrückt, deren Zusammensetzung merkwürdig und heterogen ist“.
Was Claude Lèvi-Strauss als allgemeinen Grundzug des künstlerischen Prozesses begreift, manifestiert sich ebenfalls in den materialbezogenen Objekten und temporären Projekten des Papierkünstlers Wilhelm Morat.
Morats Schaffensprozess kann sowohl vor dem Hintergrund seiner unmittelbaren Erfahrung als auch vor dem wissenschaftlicher Erkenntnisse und Diskurse gesehen werden, die in den letzten Jahren vor allem in den Printmedien diskutiert wurden. Die aus diesem Zusammenhang entwickelten künstlerischen Produkte sind Zeugnisse und Reflexionsobjekte einer Wirklichkeit, die sich durch Naturzerstörung, Ausbeutung der Rohstoffe und Energieressourcen, Massenproduktion, Effektivitätswahn und entfremdete Produktionsbedingungen auszeichnet. Dieser Wirklichkeitserfahrung versucht Morat mit einem künstlerischen Konzept zu begegnen, das mit einer bewussten Materialwahl und mit „Machen“ verbunden ist, mit dem sowohl der direkte manuelle Umgang mit dem Material, als auch das prozesshafte Eigenverhalten, das „Laisser-faire“ des Materials gemeint ist.
Objekte aus industriell gefertigtem Material
Objekte aus Tageszeitungen
Kulturmaterial Papier zwischen Transformation und „ästhetischem Recycling“
Bei den aus industriell vorgefertigtem Material erzeugten Objekten sucht Wilhelm Morat nach einer Analogie zwischen natürlichen Vorgängen und künstlerischem Schaffen, die letztendlich auch Konsequenzen für die Werkform selbst mit sich bringt, die nicht mehr als finaler Werkzustand, sondern als eine sich in der Realzeit wandelnde, vergängliche Materialsituation begriffen werden kann.
Parallel zu den temporären Projekten im Außenraum sind auch Innenraumarbeiten aus dem industriell erzeugten Kultur- und Massenprodukt „Papier“ entstanden. Papier als Druckerzeugnis und Informationsmedium ist nicht nur ein billiges und leicht verfügbares Ausgangsmaterial, sondern es besitzt sowohl einen inhaltlichen als auch physikalischen Zeitfaktor: nur für einen kurzen Augenblick entfalten die Printmedien Gültigkeit und Aktualität, um dann als kulturelles Abfallprodukt erneut Energie an die Umwelt zu dissipieren. Außer den physikalischen Eigenschaften zeichnen sich die Informationsmedien auch durch eine spezifische ästhetische Qualität aus, die für den Künstler an deren Oberfläche liegt bzw. an dem, was nach ihrer künstlerischen Verwertung und Aufbereitung noch von ihr erhalten ist. Das manuelle Verfahren des Flechtens führt zu Objekten, die die spröde, im Laufe der Zeit vergilbende Schwarz-Weiß-Ästhetik der Tageszeitung, die hin und wieder durch einige Farbabbildungen unterbrochen wird, sowie die typografische Struktur und den Informationsgehalt des Mediums im wahrsten Sinne des Wortes verdrehen und destruieren.
Die Geflechte sind komplexe Strukturgebilde, die aus Doppelseiten von Tageszeitungen gefertigt sind. Die Doppelseiten der Printmedien werden zu zigarrenförmigen Teilen gedreht und in einem weiteren Arbeitsprozess in ein Drahtgeflecht eingeflochten. Diese Zeitspeicher breiten sich raumbezogen zu Installationen aus. Ihre Gestalt bleibt variabel, mehrdeutig und flexibel und lädt zu plastischen Handlungs- und Spielformen ein. Die biotektonische Gestalt der Geflechte, die sich aus Variationen nicht identischer Elemente zusammensetzt, unterscheidet sich vom papierenen Ausgangs- und plastischen Trägermaterial insofern, dass diese einmalig, unverwechselbar und nicht wiederholbar ist, während die industrielle Massenproduktion exakt wiederholbare und identische Ergebnisse anstrebt. Die Gegenüberstellung von Regelmäßigkeit und Irregularität, von Struktur und Zufall thematisiert dabei nicht nur den Prozess des künstlerischen Schaffens, sondern weist auch hier wieder auf die Dichotomie von künstlich Gemachtem und natürlich bzw. prozesshaft Entstandenem hin.
Wenn Wilhelm Morat aus den mit hohem Rohstoff- und Energieaufwand erzeugten Printmedien singuläre ästhetische Produkte gewinnt, so kann man in diesem Zusammenhang auch von einem „ästhetischen Recycling“ sprechen, mit dem er auf metaphorische Weise versucht, dem Entropie-Prozess der Welt entgegenzuwirken.
Susanne Jakob

